Am 10. Dezember 1948 wurde die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ durch die Vereinten Nationen verabschiedet. Artikel 2 der Erklärung stellt klar, dass diese Rechte allen Menschen, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Religion, Alter oder Behinderung, gleichermaßen weltweit zustehen. Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt werden in dieser Aufzählung nicht erwähnt.
Tag der Menschenrechte
Infos zur Kampagne zum Internationalen Tag der Menschenrechte am 10. Dezember 2020
Referat für Gleichstellung, Familie und Inklusion

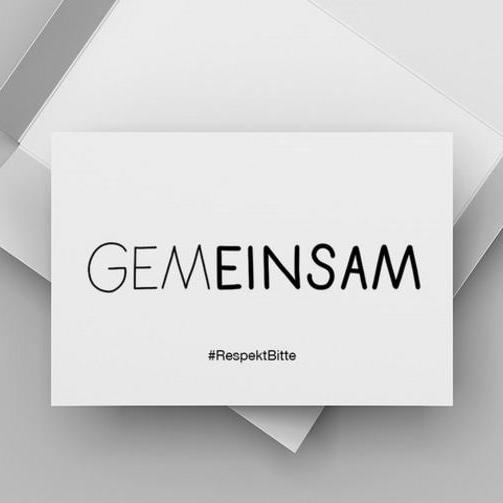
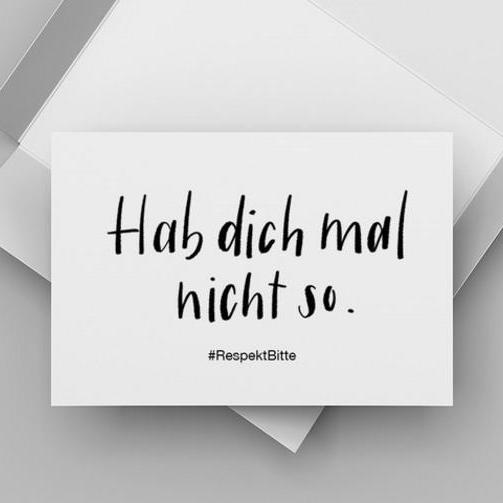
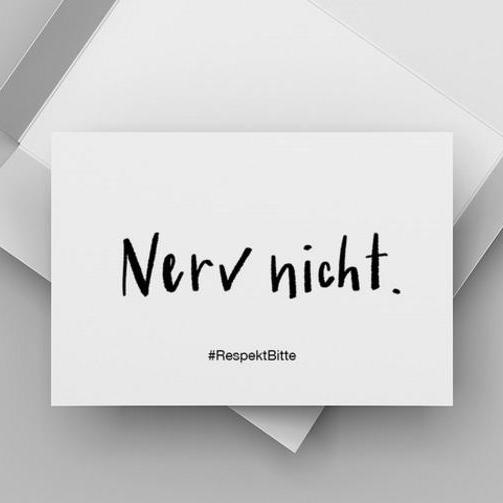


Weitere Informationen
Der 10. Dezember ist seit mehr als 70 Jahren der Internationale Tag der Menschenrechte.
Aus diesem Grunde hat, ein Zusammenschluss aus mehreren Ämtern der Stadtverwaltung* und der Rosa Strippe e.V., eine Kartenreihe im Rahmen der seit Anfang des Jahres laufenden Kampagne „Love is Respect“* entwickelt.
Weltweit gibt es noch viel zu viele Menschenrechtsverletzungen. Eine der größten ist die Gewalt gegen Frauen und Mädchen (WHO 2013).
Jede Einzelne / jeder Einzelne von uns hat bestimmt schon einmal Diskriminierung erfahren. Auch das ist eine Menschenrechtsverletzung.
So heißt es in der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ in Artikel 2:
Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand.
Auf Grundlage dieses Artikels und mit Blick auf die unterschiedlichen Diversitätsdimensionen: Geschlecht, Alter, Herkunft und Weltanschauung, Behinderung und sexuelle Orientierung und Identität, wurden die Postkartenmotive: Hab dich mal nicht so., GEMEINSAM, Nerv nicht., WILLKOMMEN, Behindert und Schwul* entwickelt.
Sie sollen ihren Beitrag dazu leisten, uns alle auf unsere unbewussten und bewussten Vorurteile aufmerksam zu machen, um dadurch Veränderung mit zu bewirken.
Die Karten liegen in der Zentralbücherei, den Bereichen der mitwirkenden Ämter und allen Apotheken und Friseuren in Bochum aus.
Nichtsdestotrotz werden nach wie vor Menschen, sowohl in Deutschland als auch weltweit aufgrund ihres Geschlechtes diskriminiert. Diese Form von Diskriminierung wird als Sexismus bezeichnet. Sexismus kann sich gegen alle Geschlechter richten. Zwar sind überwiegend Frauen von Sexismus betroffen, aber auch Männer, nicht heterosexuelle Menschen, Transgender und intergeschlechtliche Personen können Opfer von Sexismus werden.
Sichtbar wird Sexismus zum Beispiel verbal durch Witzeleien und sexuellen oder abwertenden Bemerkungen als auch durch traditionelle geschlechtsspezifische Rollenzuschreibungen. Mit negativen Zuschreibungen, wie zum Beispiel „Frauen können nicht Auto fahren“ und anderen Kompetenzabsprachen oder sexuell anzüglichen Bemerkungen werden Frauen im Laufe ihres Lebens immer wieder konfrontiert. Diskriminierende Bemerkungen werden von den geäußerten Personen jedoch oftmals als Komplimente ausgewiesen und das Empfinden der betroffenen Person mit den Worten „Hab‘ dich mal nicht so“ abgewertet.
Auch wenn Menschen durch ihr Erscheinungsbild und ihrem Verhalten nicht die traditionellen Geschlechterbilder erfüllen und von dem abweichen was als typisch „weiblich“ und typisch „männlich“ angesehen wird, erfahren sie oftmals Negativität und Ablehnung. Kompetenzen und Verhaltensweisen werden jedoch nicht einfach dadurch erlernt, dass man eine Frau oder ein Mann ist, vielmehr werden sie im Lebensverlauf individuell erworben. Nichtsdestotrotz sind solche Vorurteile und negativen Zuschreibungen nach wie vor weit verbreitet da viele Menschen diese Geschlechterbilder nach wie vor als selbstverständlich ansehen. Somit ist Sexismus ein strukturelles Problem, welches gesellschaftlich verankert ist. Es führt sowohl zu ungleichen Machtverhältnissen zwischen den Geschlechtern als auch zu unterschiedlichen Lebenschancen der Individuen.
Mit der Verabschiedung des Allgemeinen Gleichstellungsgesetzes im Jahr 2006, sind diskriminierende sexistische Äußerungen gesetzlich verboten.
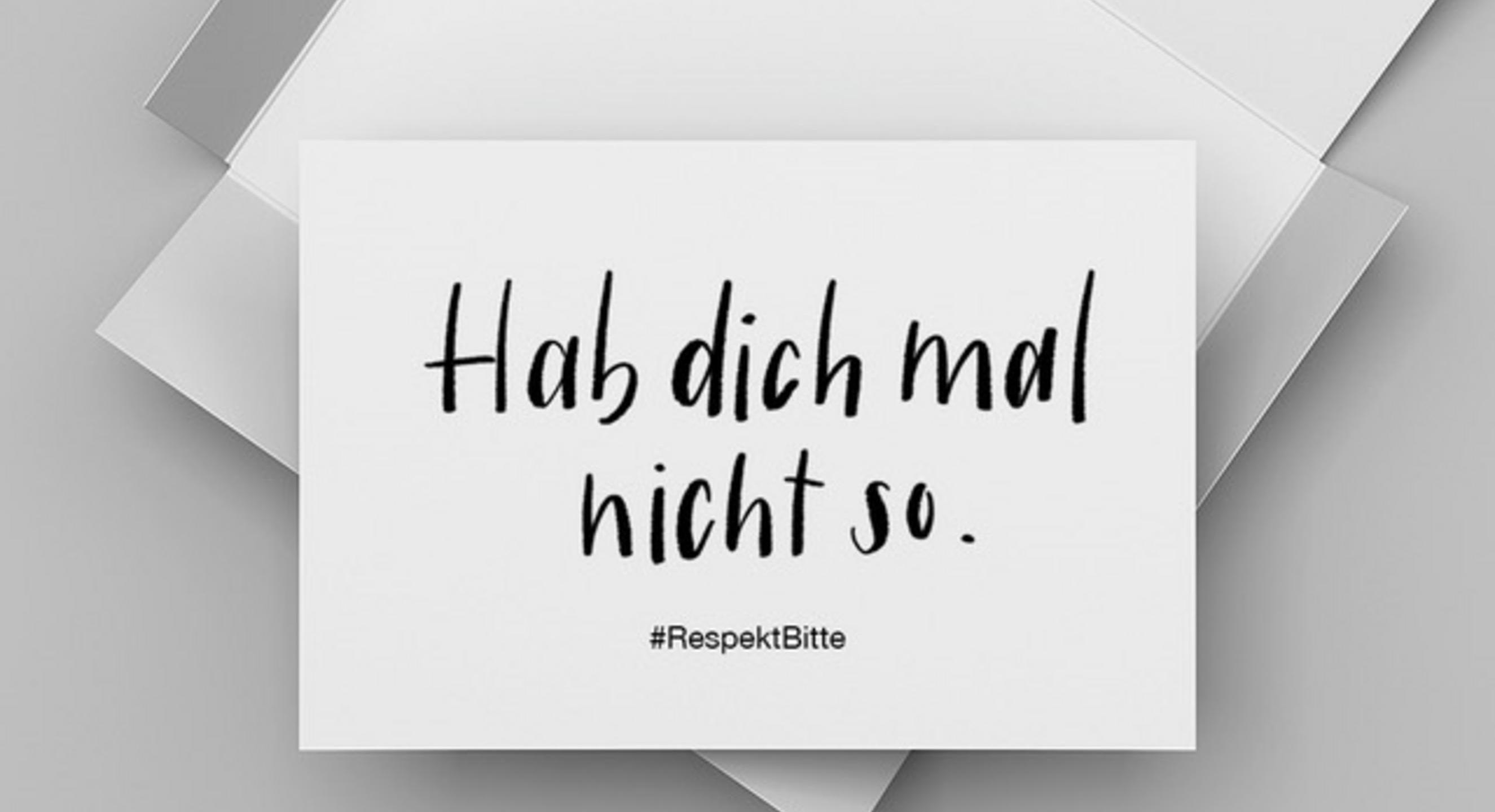
Nach wie vor werden Menschen aufgrund ihres Altes diskriminiert. Dabei wird von Altersdiskriminierung gesprochen, wenn ein Mensch aufgrund seines Alters nachteilig behandelt wird. Altersdiskriminierung kann sich zum Beispiel in Form von beleidigenden Bemerkungen aufgrund des Alters oder in Form von altersbegrenzender Regeln, Kriterien oder Vorschriften äußern.
Nicht nur alte Menschen sind von Altersdiskriminierung betroffen. Auch junge Menschen können Diskriminierung aufgrund ihres Alters erleben. Dies geschieht zum Beispiel, wenn diese aufgrund ihres Alters nicht ernstgenommen werden und ihre Meinung, Erfahrungen und bisherigen Erfolge aufgrund des jungen Alters abgewertet oder ihnen gänzlich abgesprochen werden. Oftmals findet diese Form der Diskriminierung im Arbeitskontext statt, sodass den betroffenen Menschen erschwert wird an diesem teilzunehmen.
Sind alte Menschen von Altersdiskriminierung betroffen, so wird es ihnen erschwert am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Als Konsequenz dessen können sie sich einsam fühlen, da es ihnen an Gemeinschaft mangelt. Insofern ist die Gemeinschaft wichtig, um die Einsamkeit zu überwinden.

Nach wie vor werden Menschen in unserer Gesellschaft an ihrer Entfaltung und in ihrem Alltag behindert. Diese Behinderung kann durch vorhandenen gesellschaftlichen Strukturen, durch Vorurteile, Stereotype oder Unsicherheiten im Umgang miteinander stattfinden.
Dabei könnte man nun meinen, wir sprechen von allen Menschen die dieses betreffen könnte. Doch wollen wir hier explizit auf die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung hinaus. Oft ist nicht die Einschränkung an sich die „Schwierigkeit“, sondern dass was aus ihr gesellschaftlich, strukturell und im persönlichen Umgang miteinander gemacht wird. Es geht sogar so weit, dass „Du bist ja behindert“ ein sehr häufig genutzter Ausspruch gerade unter jungen Menschen ist, und damit gemeint wird, dass jemand eine schlechte Einschätzung vornimmt oder einen schlechten Vorschlag gemacht hat.
In diesen Zusammenhängen wird „behindert“ als Synonym für doof oder blöd verwendet. Es wird damit zum Schimpfwort, zur Abwertung zur Beleidigung des Gegenübers und zur Reduzierung auf das Unvermögen oder ggf. auf die Behinderung.
Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen findet auch immer dann statt, wenn Menschen auf Grund ihres Handicaps abseits aller vorhandenen Angebote als eigene Gruppe definiert und betrachtet wird. Es muss Inklusion gelingen statt Integration.
In unserem Verständnis bedeutet das, dass möglichst keine gesonderten Angebote für Menschen mit Behinderung geschaffen werden sollen und müssen. Ganz im Gegenteil. Die vorhandenen müssen stattdessen darauf überprüft werden, in wieweit dort Hemmnisse, Hürden und Zugangsbarrieren abgebaut werden können und was zukünftig dann als neues „Regelangebot“ für alle angeboten werden kann.
Gesetzlich und im Rahmen von Richtlinien ist dies bereits schon länger festgeschrieben zum Beispiel in der UN Behinderten Konvention, doch es fehlt zurzeit in vielen Bereichen noch an der tatsächlichen, echten Umsetzung dessen.

Nach wie vor sind Junge Menschen und Kinder von stereotypen Annahmen bezüglich ihres Alters betroffen. Zu häufig werden sie nicht ernst genommen oder als naiv, unreif oder mit den Worten: „Nerv nicht.“ als anstrengend abgestempelt. Ihre Erfahrung und ihr Erfolg werden heruntergespielt und ihnen wird abgesprochen, eine eigene Meinung zu haben oder haben zu dürfen.
Meist ist die Diversitäts- Dimension „Alter“ nicht in unterschiedliche Lebensphasen unterteilt. Doch jede Altersgruppe hat mit ihren eigenen Vorurteilen zu kämpfen.
Seit nun fast 30 Jahren gilt die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen in Deutschland. Genauso lange wird bereits darüber diskutiert, Kinderrechte ausdrücklich im Grundgesetz zu verankern. Der aktuelle Koalitionsvertrag sieht eine solche Grundgesetzänderung vor.
Die wichtigsten zehn Kinderrechte sind:
- Gleichheit
- Bildung
- Gewaltfreie Erziehung
- Schutz vor Missbrauch und Ausbeutung
- Spiel und Freizeit
- Gesundheit
- Elterliche Fürsorge
- Freie Meinungsäußerung
- Schutz im Krieg und auf der Flucht
- Betreuung bei Behinderung

Auch heute noch ist ein gelingendes und solidarisches Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft nicht selbstverständlich. Aber genau das sollte unser Ziel sein.
Das Leben von Kulturen und Überzeugungen braucht viele Menschen, ob zugewanderte oder heimisch, die im Alltag rücksichtsvoll und verständnisvoll handeln. Dabei ist es wichtig, auf einer gemeinsamen Wertegrundlage: Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit, Zusammenleben zu gestalten und zu erhalten.
Diese gemeinsamen Werte sind nicht selbstverständlich und werden immer wieder angegriffen. Menschenfeindlichkeit und Demokratiefeindlichkeit trägt viele Gesichter: Rechtsextremismus, Rassismus, islamischer Extremismus, Antisemitismus, Antiziganismus oder linker Extremismus.
Die Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist eine gemeinsame Aufgabe Menschenfeindlichkeit entschieden entgegenzutreten.
Eine solche Stimmung muss einer Atmosphäre des Willkommenseins weichen und Aufgeschlossenheit von allen Seiten herzustellen und zu leben.
Damit wollen wir die Integration aller Menschen, in die Gesellschaft, die dauerhaft in unserem Land leben, erreichen. Das Betrifft uns alle- die Alteingesessenen ebenso wie die Zugewanderten.

LSBT*I*Q ist eine Abkürzung und steht für lesbisch, schwul, bisexuell, trans*, inter* und queer. Während sich LSB den sexuellen Orientierungen zuordnen lassen, stehen T* und I* für die geschlechtliche Identität. Das Q steht als Überbegriff für nicht-heterosexuelle und/oder nicht-cis-geschlechtliche Menschen.
Mit der 2017 eingeführten sog. „Ehe für alle“ ,hier in Deutschland, wurden auch gleichgeschlechtliche Paare eherechtlich gegenüber heterosexuellen Paaren gleichgestellt. Doch sowohl gesellschaftlich als auch politisch bleiben im Jahr 2020 noch vielen Themen offen.
Auch heute noch haben viele Jugendliche Angst vor ihrem Coming Out. Angst vor Ausgrenzung, Abwertung, Mobbing oder sogar Gewalterfahrungen im Freundes- und Bekanntenkreis, in der Familie und in der Schule.
Der Ausspruch „Du bist ja wohl schwul“ steht immer noch als Schimpfwort auf den Pausenhöfen hoch im Kurs.
Und auch mehr als die Hälfte aller LSBTIQ-Personen hält die sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität am Arbeitsplatz geheim.
Das gerade von der Bundesregierung verabschiedete Gesetz zum „Schutz vor Konversionstherapien“ wurde trotz Kritik von der Opposition und von Interessensverbänden in einer sehr lückenhaften Version beschlossen. „Behandlungen“ zur „Heilung“ von Homosexualität, welche bei den Betroffenen schwere psychische Schäden bis hin zum Suizid verursachen können, sind somit in Deutschland weiterhin möglich.
Trans*-Personen wird durch das sog. „Transsexuellengesetz“ die Selbstbestimmung bei der Namens- und Personenstandsänderung verwehrt.
Es sind teure und demütigende Anerkennungsverfahren für die Änderung von Geburtsurkunde und Personalausweis nötig.
Ferner sind auch weiterhin Operationen an inter*-Kindern zur Herstellung einer Geschlechtseindeutigkeit in Deutschland erlaubt.
Diese Vielzahl an ausschließenden Begrenzungen und nicht selbst wählbaren Bedingungen und Sonderregelungen machen deutlich, dass vieles was bereits rechtlich festgeschrieben wurde, noch sehr lückenhaft ist und sich darüber hinaus noch viele Vorschriften sehr stark an alten herkömmlichen Sichtweisen orientieren. Eine diskriminierungsfreie und individuelle Entfaltung ist noch lange keine Praxis in unserer Gesellschaft.
